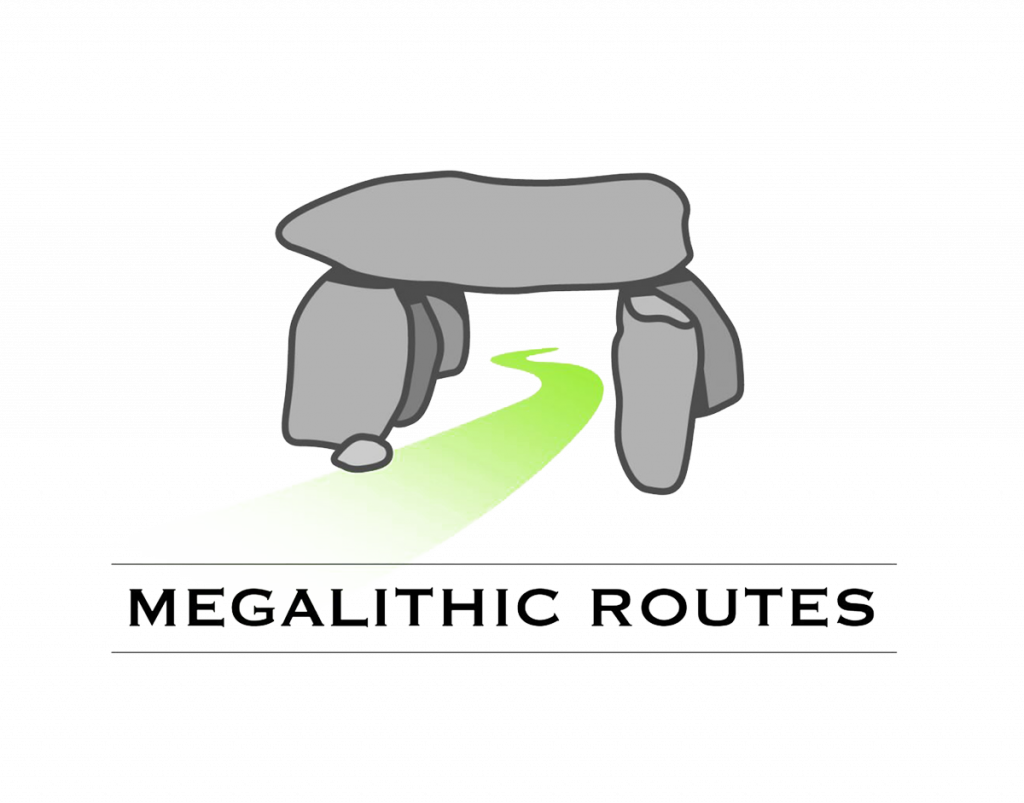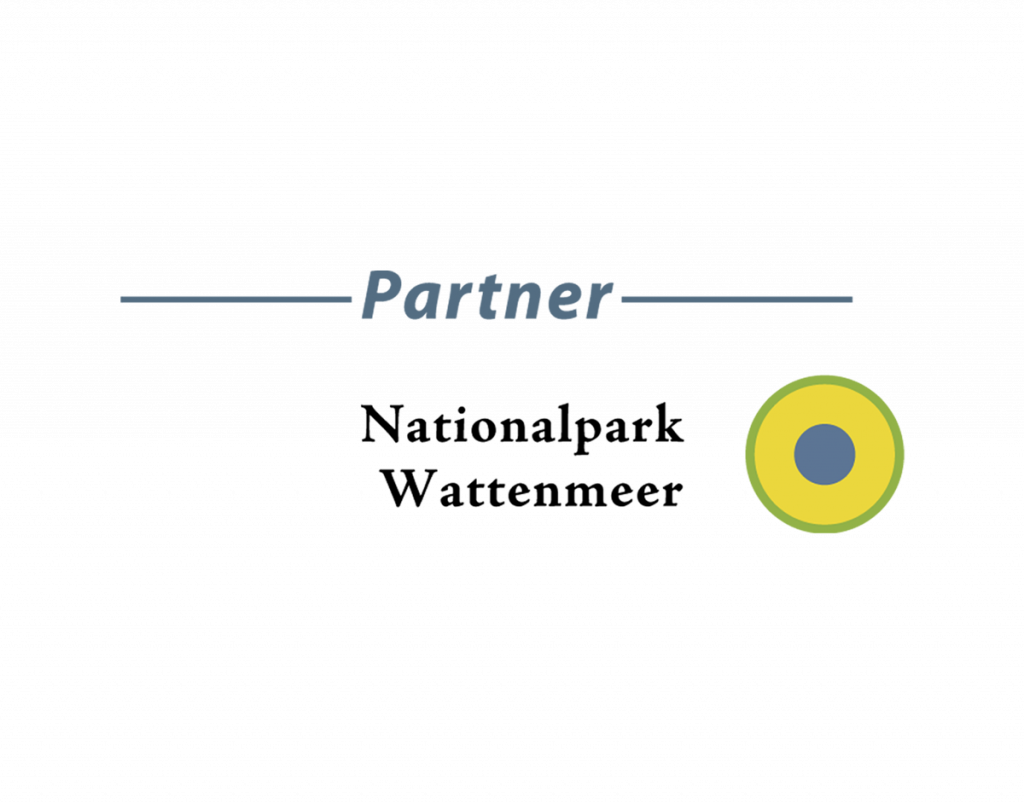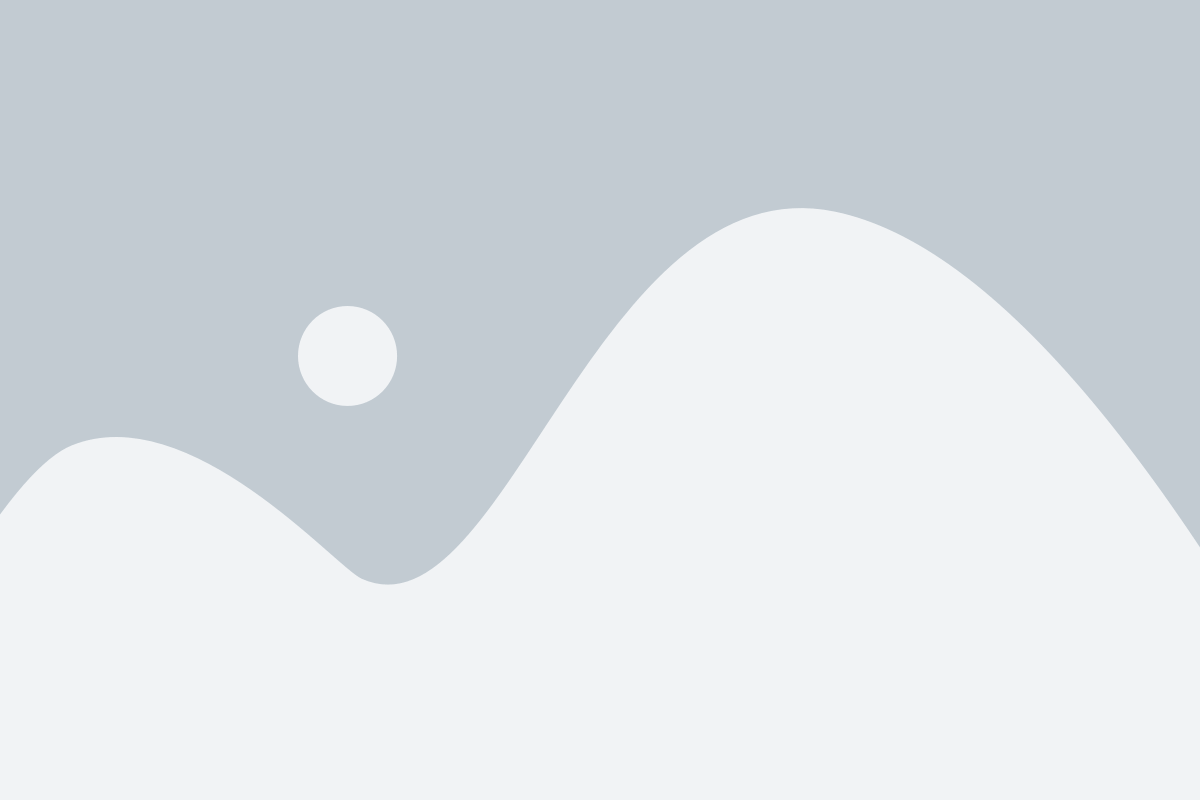Der Steinzeitpark Dithmarschen
Das Konzept der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ als Chance für die Archäologie
Von Rüdiger Kelm, Albersdorf
Der Steinzeitpark Dithmarschen hat sich von Anfang seines Bestehens an nicht als rein bzw. allein museale Institution in der Region, sondern auch als eine die kulturelle, ökologische und wirtschaftliche (touristische) Entwicklung begleitende und – soweit möglich – auch fördernde Einrichtung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Sinne der internationalen Agenda 2030 und der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele für die Region gesehen. Unter Nachhaltigkeit ist hierbei zu verstehen, dass die in einer Region agierenden Menschen wirtschaftliche, ökologische und soziale Standards miteinander verknüpfen und umsetzen, die gewährleisten, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden können, ohne dabei die Bedürfnisse der folgenden Generationen zu missachten. Die Grundlagen der BNE in der Umwelterziehung und in der entwicklungspolitischen Bildung besonders der 1980er Jahre sind in diesem Ansatz wiederzuerkennen. Der pädagogische Ansatz der BNE hat dabei zum Ziel, Lerninhalte in neue Beziehungen zueinander zu setzen und Methoden zu vermitteln, die den erlernten Stoff im konkreten Fall abruf- und anwendbar werden lassen.
Die Nutzung von BNE:Kriterien in archäologischen Einrichtungen kann dabei viele Formen und Methoden umfassen. Beispielhaft können durch die im Folgenden aufgeführten Themenkomplexe und Vermittlungsansätze Bezüge zur Agenda 2030 und den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen hergestellt werden:
Bedrohte Nutztiere und Nutzpflanzen (Ernährung)
Verständnis für fremde/historische/„archäologische“ Völker (auch im kritischen Vergleich mit heutigen indigenen Völkern außerhalb Europas)
Probleme durch (intensive) Landnutzung/Landwirtschaft früher und heute
Historische Kulturlandschaften – (regionale) Kennzeichen, Erhaltung und Pflege (nachhaltiges Management)
Bauen und Wohnen in der Steinzeit (Nutzung von Naturmaterial wie Lehm, Holz etc.)
Kritische Auseinandersetzung mit der Mensch-Umwelt-Beziehung in der Vergangenheit (Erlangung von Schlüsselkompetenzen).
Diese Liste kann beliebig fortgeführt werden und illustriert, wie BNE gerade auch im archäologischen Bildungsbereich konkret umgesetzt werden kann und sollte. Auch die Archäologie als Wissenschaft ist im Übrigen betroffen, denn die ethnoarchäologische Feldforschung findet speziell auch im Bereich der traditionellen Techniken (im Sinne immateriellen Kulturerbes) durch die fortschreitende Globalisierung kaum noch ausreichende Ansatzpunkte für verschiedene Fragestellungen vor. Dringender Handlungsbedarf ist hier gegeben.
Sowohl die Archäologie als auch die Ethnologie beschäftigen sich als Disziplinen mit den natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen, mit der Nutzung von Ressourcen und mit den Möglichkeiten der Anpassung an diese bzw. mit der Manipulation derselben. Der BNE-Ansatz bei der Vermittlung archäologischer Themen ermöglicht nicht zuletzt in Kombination mit der Ethnologie neue Zugänge zu diesen auch für den modernen Menschen bedeutenden Grundfragen des Daseins; es kann eine erhöhte Wertschätzung körperlicher Arbeit zur Folge haben und bezieht die in der BNE häufig vernachlässigte zeitliche Dimension in die Betrachtung mit ein.
Vor allem aber auch der besondere Blick der Archäologie auf „das Fremde“ – der in der Zeit und nicht unbedingt im Raum geschieht – kann zum Verständnis, zur Achtung und im besten Falle zur Toleranz anderer (eben auch vergangener) Kulturen führen. Dies ist die Stärke und kann zukünftig der spezifische Beitrag der Archäologie zum Themenkomplex BNE sein, den die Ethnologie in einer solchen historischen Tiefe nicht zu leisten imstande ist.
Wie kann ein solcher Anspruch konkret in einer archäologischen Einrichtung umgesetzt werden? Bei den pädagogischen Veranstaltungen des Steinzeitparks Dithmarschen in Albersdorf bilden jeweils ein handlungs- und ein erlebnisorientierter Teil den Schwerpunkt des Programms. Generell finden diese Angebote in der weit gehend authentischen Lernumgebung des „Steinzeitdorfes“ statt und bestehen immer aus einem einführenden instruktiv-erläuternden Teil von Seiten der betreuenden Pädagog:innen und einem konstruktiv-praktischen Teil auf Seiten der Teilnehmer:innen. Durch die Programme sollen die Sachkompetenz (Wissen und Einsichten), die Methodenkompetenz (Fertigkeiten und Techniken), die Sozialkompetenz (Verhalten in der Gruppe und interaktives Handeln) sowie die Selbstkompetenz (selbstverantwortliches Handeln) der Teilnehmer zu den spezifischen, im Steinzeitpark dargestellten Themen verbessert werden.
Bei all diesen Kompetenzen handelt es sich um Schlüsselkompetenzen im Sinne der BNE, die zur Lebensqualität beitragen können, die in verschiedenen zentralen Lebensbereichen anwendbar sind und die für alle Individuen eine Relevanz besitzen. Mit verschiedenen, für die damalige Zeit typischen Rohstoffen und Werkzeugen werden deshalb im Steinzeitpark durch eine möglichst authentische Arbeits- und Herstellungsweise die tägliche Arbeit der Steinzeitmenschen praktisch dargestellt sowie pädagogisch akzeptable, teilweise von ethnologischen Vorbildern beeinflusste Kopien von Geräten hergestellt, welche so die historischen Lebens- und Umweltbeziehungen besser verständlich machen können. Durchschauen und Verstehen stehen als Vermittlungsprinzip im Vordergrund.
Literatur und Weblinks
R. Kelm 2006: Die frühe Kulturlandschaft der Region Albersdorf – Grundlagen, Erfassung und Vermittlung der urgeschichtlichen Mensch-Umwelt-Beziehungen in einer Geestlandschaft. EcoSys – Beiträge zur Ökosystemforschung, Suppl. Bd. 45 a (Kiel 2006).
Zu den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen:
17ziele.de
bundesregierung.de
schleswig-holstein.de
Zur Zertifizierung von Bildungsakteuren in Norddeutschland als BNE-Einrichtung:
www.nun-zertifizierung.de